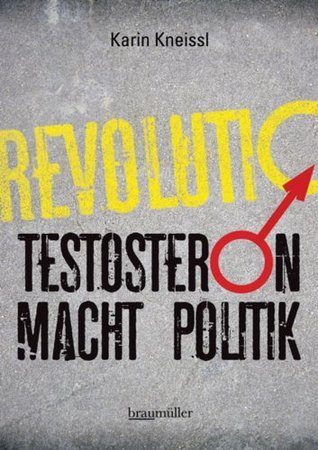FPÖ-Chef Strache hätte mit Karin Kneissl gerne einen „weiblichen Kreisky“ (derStandard) als Außenministerin installiert. Der Ausdruck war geschickt gesetzt und geistert seit ihrem Amtsantritt im Dezember 2017 als Bonmot zu der parteilosen Publizistin und Nahostexpertin durch die Medien (etwa SN, Presse, Kurier). Und Kneissl selbst gefällt sich offenbar auch in dieser Rolle (Interview mit Krone). Die Kreisky-Analogie macht aus der Not eine Tugend: Aufgrund des Mangels an kompetentem Personal und der Verlegenheit, dass man offenbar (noch) kein freiheitliches Schmissgesicht an der außenpolitischen Spitze platzieren kann, wird eine „parteilose Expertin“ berufen und gleich zum „weiblichen Kreisky mit kontroversen Positionen“ (News) geadelt. Ein sehnsüchtiger Versuch an die Ära von Österreichs „aktiver Neutralitätspolitik“ anzuknüpfen. Kneissl soll „Brückenbauerin“ und Vermittlerin am internationalen Parket sein. Doch die Empirie straft diesen (tatsächlichen oder behaupteten) Anspruch Lügen: Russland lässt Kneissl als Vermittlerin in Syrien abblitzen (Kurier) und Israel beschränkt die diplomatische Beziehung auf „beruflichen Kontakt“ (wie gegenüber allen Freiheitlichen; ORF).
Die Vermittlerrolle funktioniert schon eher nach Innen: Kneissl vertritt FPÖ-Ideologie, ohne Parteimitglied zu sein und ohne Parteiorthodoxie auszustrahlen. Sie vermittelt rechtsaußen Positionen gekonnt mit dem Mainstream des medialen Jargon (1). Denn was bei den Freiheitlichen oftmals miefig und abgestanden daherkommt, klingt bei Kneissl pfiffig, up to date und professionell. Reaktionär ist es allerdings immer. Das liegt an Kneissls gesellschaftspolitischen Prämissen, die schnell einmal von ihrem Faktenwissen – das sie bei absolut jeder Gelegenheit präsentiert – verdeckt werden. Diese Prämissen sind inhaltlich vollkommen kompatibel mit ihrer Ticket-Partei, der rechtsextremen FPÖ.
Pro Putin-Russland
Kneissls außenpolitische Positionierung zu Russland lässt mutmaßen, dass sie ganz auf Linie mit dem dubiosen Arbeitsvertrag zwischen FPÖ und Putins Partei „Einiges Russland“ ist. Erst diese Woche plädiert sie in „Die Welt“ dafür, Russland wieder „als Partner zu begreifen“ (Presse); und beginnen könnte man mit dieser partnerschaftlichen Annäherung in Syrien oder im Jemen, also dort wo Russland eine aggressive Kriegspolitik betreibt. Diese Anbiederung passiert ohne Not. Dazu plädiert sie für weniger „Misstrauen“ gegenüber Russland. Das klingt angesichts der vielfach nachgewiesenen Gründe für eben dieses Misstrauen – brutaler Autoritarismus, Kriegstreiberei, gezielte Destabilisierung anderer Staaten durch Desinformationskampagnen – nicht nur naiv, sondern schon nah an jenen Verschwörungstheorien, die Putins Trollarmeen in die Welt streuen.
Die jüngsten Aussagen Kneissls überraschen eingedenk älterer Wortmeldungen von ihr nicht allzu sehr. So hat sie schon früh die russischen Militärinterventionen im syrischen Bürgerkrieg aufseiten des Massenmörders Assad als neue „diplomatische Dynamik“ begrüßt (Kleine Zeitung, 2015; Kurier, 2018). Außerdem ist sie auffällig geworden, als sie auf Servus TV unhaltbare Theorien zu den Giftgasanschlägen um Damaskus verbreitete und sich damit, einem kritischen Nahost-Think-Tank zufolge, „de facto in den Dienst der Desinformationskampagnen syrisch-russischer Provenienz“ gestellt hat (siehe bei Mena-Watch). Kurzum: Kneissl war bereits vor dem bizarren Vernetzungstreffen mit Putin bei ihrer eigenen Hochzeit durchaus von der freiheitlichen Russlandfaszination angesteckt.
Antifeminismus – Biologismus I
Kneissls Buch „Testosteron Macht Politik“ (2012) – ja, es heißt wirklich so – beginnt mit dem Satz: „Will man Politik verstehen, muss man die Natur des Menschen begreifen.“ (S. 9) Dies will sie offenbar auf 130 Seiten leisten. Und das funktioniert auch, denn Kneissl hat eine Zauber-Kategorie gefunden, mit der sich plötzlich alles ganz einfach erklären lässt: Testosteron.
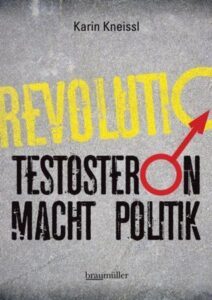
Sie möchte also politische Verhältnisse anhand des Sexualhormons Testosteron analysieren, selbstredend ohne dabei „in einen biologischen Determinismus zu verfallen“ (S. 12). Dass etwa Männer historisch die „wesentlichen Akteure“ bei Revolutionen waren, will Kneissl auf solch „tiefere biologische Gründe“ (S. 18) zurückführen. Denn Männer seien fokussierter, spontaner und zum Opfer bereiter, und das habe mit Erziehung nichts tun, sondern mit Biologie und Evolution. Oder konkreter: Das liege am „Hormon Testosteron, welches das männliche Lebewesen zum Manne macht“ (S. 19). Voller Pathos präsentiert Kneissl diese unsäglichen Behauptungen aus dem vorletzten Jahrhundert. Durch die Hormonbrille betrachtet macht auf einmal alles Sinn!
Es klingt praktischerweise ein kleines bisschen weniger reaktionär, wenn von testosterongesteuerten Männern die Rede ist, aber das rigid binäre Verständnis von Geschlecht zwingt zum Umkehrschluss. Kneissl sagt also auch: Frauen seien aufgrund ihrer Biologie weniger fokussiert, passiver, ängstlicher und nicht zur Aufopferung für die große politische Sache bereit. Der männliche Wettbewerbsgeist wird folgerichtig auch biologisch erklärt, nämlich als „Zusammenwirken zwischen Testosteron und Status“ (S. 20). Zugespitzt klingt das dann so: „Der Mann als Beschützer und Ernährer, die Frau als Mutter und zu beschützendes Wesen sind uralte, von der Evolution vorgegebene Rollenbilder.“ (S. 20) Von dieser antifeministischen Welterklärungsformel leitet Kneissl dann Kriege, Aufbegehren gegen Armut und Revolutionen ab. Das versucht sie u.a. mit Zitaten von Bertold Brecht und Hannah Arendt zu unterfüttern, nur dass die zitierten Stellen rein gar nichts mit Kneissls vulgärem Biologismus zu tun haben (S. 20–21).
Kneissl stellt ganz offen die Errungenschaften des gesamten Feminismus in Frage (bis zurück zu Simone de Beauvoir). Dies tut sie mit der hanebüchenen Vereinfachung, die „Neurologie mit verfeinerten Messmethoden“ (S. 73) habe inzwischen ja doch bewiesen, dass es im Hirn mit Hormonen zugeht.
Kneissls These ist eine bizarre biologistische Komplexitätsverweigerung, die in einer Stammtischphrase kulminiert: „Wir sind offensichtlich Primaten unter Primaten, die ihre Reviere verteidigen.“ (S. 12) Damit wären emanzipatorische Bestrebungen naturgemäß eher sinnlos. Was der FPÖ gefallen dürfte.
1 So gesehen ist sie tatsächlich eine Brückenbauerin à la Kreisky: Sie verbindet die Burschenschafter-FPÖ mit Horizonten außerhalb des völkischen Dünkels, so wie seinerzeit Kreisky die (noch sehr frisch) nachnazistische FPÖ mit dem politischen Mainstream verband (zur Schattenseite Kreiskys siehe demokratiezentrum.org).
Quelle: Kneissl, Karin (2012): Testosteron Macht Politik. Wien: Braumüller