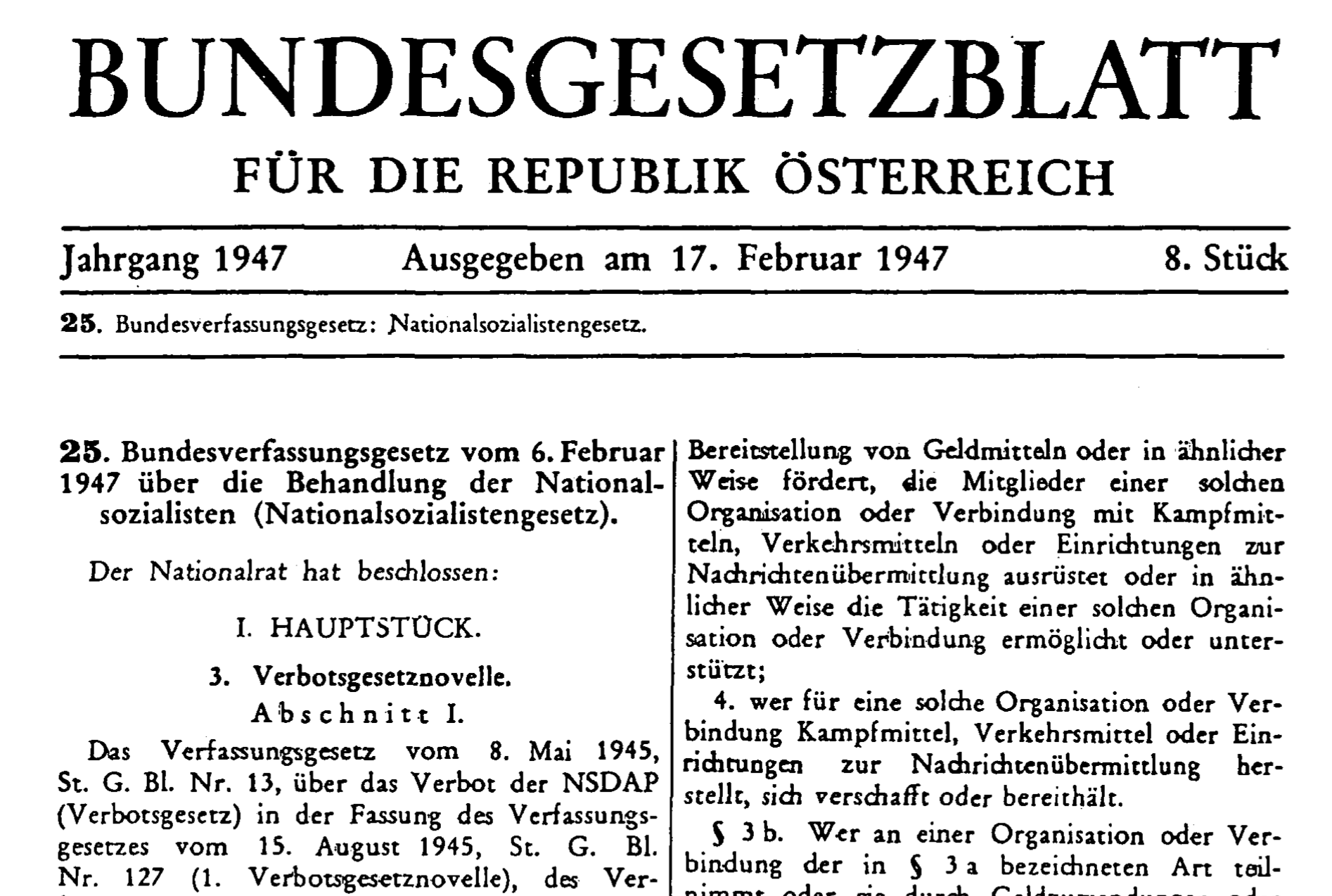Bereits in der letzten Woche haben wir von einem Grundsatzentscheid des OGH berichtet, wonach Mails an ÖsterreicherInnen mit Inhalten, die an sich unters Verbotsgesetz fallen würden, hierzulande nicht zu bestrafen sind, wenn sie vom Ausland abgeschickt werden, denn – so der OGH – die Tat sei mit dem Abschicken des Mails vollendet worden, also nicht in Österreich.
Das Verbotsgesetz wurde, wie wir wissen, in Zeiten formuliert, als das Internet noch nicht existierte, Anpassungen fürs digitale Zeitalter gab es nicht. Die Ansicht des OGH, dass der Ort entscheidend sei, wo die Tat vollendet wurde, lässt Interpretationen zu, da ein Posting oder das Verschicken von Mails nicht nur fast zeitgleich mit dem Eintreffen bei den AdressatInnen einhergeht, sondern auch der Begriff „vollendet“ dehnbar ist. Niemand würde auf die Idee kommen, etwa einen Anschlag mittels einer Bombe dann als vollendet zu betrachten, wenn Sprengstoff und Zeitzünder am Ort deponiert sind, also noch bevor es die intendierte Explosion gegeben hat.
Die Möglichkeiten, im Internet seinen Standort zu verschleiern, gibt es schon länger. Ein Mail mittels einer VPN-Verbindung kann mithilfe einer nicht österreichischen IP-Adresse quasi ein anderes Land als Standort simulieren, der Absender also potentiell vortäuschen, nicht in Österreich bei „Vollendung“ seiner Tat gewesen zu sein. Auf die technischen Neuerungen, die sich in den letzten Jahrzehnten ergeben haben, hat der Gesetzgeber zumindest beim Verbotsgesetz nicht reagiert.
Der Jurist Oliver Plöckinger führt aber in einem Kommentar in „Die Presse“ (11.2.19, S. 15) neben juristischen Argumenten auch „kriminalpolitische Gründe“ an, die gegen die Auslegung des OGH sprechen:„Das Verbreiten von NS-Gedankengut tangiert in hohem Maße Interessen Österreichs, dessen Geschichte untrennbar mit den Gräueltaten während des Holocaust verbunden ist. Die Justiz trifft bei der Wahrnehmung dieser Interessen eine besondere Verantwortung. E‑Mails mit NS-Inhalten, welche in Österreich ‚aufschlagen’, sind ausnahmslos hier zu ahnden. Der Schritt über die Grenze in ein Land, das kein Verbotsgesetz kennt, soll Neonazis nicht in Sicherheit wiegen, ihre Inhalte in Österreich unbehelligt verbreiten zu dürfen. Das wäre wohl eindeutig das falsche Signal.“
Aus dem Justizministerium heißt es, man wolle nun „prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass es [im Ausland begangene Delikte, Anmk. SdR] in Zukunft strafbar sein kann“, heißt es laut „Presse“ (8.2.19, S. 7). Das kann nicht so schwierig sein, wenn wir auf die Praxis bei anderen Delikten schauen: „Doch es gibt Ausnahmen. So kennt das österreichische Strafgesetzbuch bereits jetzt bestimmte Delikte, für die der Täter belangt wird, auch wenn er im Ausland gehandelt hat. Darunter fallen Taten, die sich gegen den österreichischen Staat richten, etwa die Vorbereitung eines Hochverrats, Landesverrat oder auch bestimmte Handlungen gegen das Bundesheer. Bei manch anderen Delikten (etwa Sexualtaten oder Folter) schreitet die österreichische Justiz unabhängig vom Tatort dann ein, wenn der Täter Österreicher war.“ (Die Presse, 8.2., S. 7)
Außerdem erinnern wir einmal mehr daran: Ex-Justizminister Brandstetter hat vor zwei Jahren eine Evaluierung des Verbotsgesetzes und eine etwaige Adaptierung versprochen. Vor einem halben Jahr haben die Grünen im Bundesrat in Kooperation mit SdR eine parlamentarische Anfrage an Justizminister Moser gerichtet und nachgefragt, was denn aus Brandstetters Vorhaben geworden ist. Vom Ministerium hat es geheißen, man sei gerade dabei, Rückmeldungen aus anderen Staaten auszuwerten und eine Studie bei einer wissenschaftlichen Einrichtung in Österreich in Auftrag zu geben. Wir wetten, dass diesbezüglich noch nichts passiert ist. Aber falls es jemals so weit kommen wird, sollte die oben beschriebene Problematik gleich umfassend mitstudiert werden.