Es ist bereits der vierte Band aus der Reihe „Rechtsextremismus“ der „Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit“ (FIPU), der da jüngst im umtriebigen Wiener Mandelbaum-Verlag erschienen ist. Das Leitthema „Herausforderungen für den Journalismus“ klingt zunächst einmal etwas spröde. Im Buch umgesetzt, stimmt das jedoch nicht, denn die Beiträge der Autor*innen bieten – aus sehr unterschiedlichen Perspektiven – viele Anregungen und Einblicke. Eine Rezension von Karl Öllinger.
Von den Titeln einzelner Beiträge sollte man sich nicht abschrecken lassen. „Entnormalisierung und Positionierung“ heißt der erste, quasi programmatische, den die Forschungsgruppe gemeinsam zeichnet. Der Untertitel „Über Rechte reden in rechten Zeiten. Mit Rechten reden zur rechten Zeit?“ macht dann schon klarer, was in dem Beitrag verhandelt wird: Wann und unter welchen Voraussetzungen kann man mit Rechtsextremen eine öffentliche Debatte führen? FIPU reflektiert dabei auch die Veränderungen der Rahmenbedingungen: 1991 hat der Verfassungsgerichtshof die Wahlanfechtung der Neonazi-Liste „Nein zur Ausländerflut““ des Gerd Honsik unter anderem mit der Begründung zurückgewiesen, dass sie ein für die NSDAP typisches Propaganda-Vokabular verwendet habe, und führte als Beispiel dafür die häufige Verwendung des Begriffs „Überfremdung“ an. Nicht einmal zehn Jahre später wurde die Parole „Stop der Überfremdung!“ in Wien dann von der FPÖ „flächendeckend plakatiert“. Zu diesen Veränderungen der Rahmenbedingungen gehört dann auch die von FIPU zitierte zynische Aussage von Kanzler Kurz aus dem Jahr 2018: „Vieles von dem, was ich heute sage, ist vor drei Jahren noch massiv kritisiert und als rechtsradikal abgetan worden, das hat sich geändert.“
Was da in den einzelnen Beiträgen an Scheußlichkeiten oder Fundstücken zu Tage gefördert wird, lohnt alleine schon den Kauf des Büchleins (19 €) im Pocketformat, das mit seinen 300 Seiten gar nicht so schmal daherkommt. Ein Beispiel noch? Mathias Lichtenwagner liefert in seinem Beitrag „Kooperation, Kontrolle, Korrektiv“ (Untertitel: „Journalismus, Polizeiarbeit und NS-Wiederbetätigung“) nicht nur einen Überblick über alle relevanten Anti-NS-Gesetze, sondern vor allem Einblicke in die Anwendung dieser Gesetze durch die Polizei und ihre Verarbeitung in polizeilichen Statistiken. Da findet sich dann auch eine besondere Perle, mein persönliches Highlight: Ein Kärntner Verfassungsschützer erklärt dem Landesgericht Klagenfurt, dass die von dem Angeklagten gezeigte Handbewegung bei der rechtsextremen Bleiburg-Feier 2017 nicht den Hitlergruß, sondern den deutlich davon zu unterscheidenden „kroatischen Gruß“ darstelle. Das Gericht zeigt sich irritiert und vertagt, um einen Sachverständigen zu laden. Der, ein Professor an der Universität Zagreb, erklärt dem Gericht, dass es gar keinen eigenständigen „kroatischen Gruß“ als Geste gebe, sondern der Hitlergruß 1941 1:1 vom faschistischen kroatischen NDH-Regime übernommen wurde. Lichtenwagner bilanziert nüchtern: „Der Kärntner Verfassungsschutz ging demnach über Jahre fälschlicherweise davon aus, dass die während des Treffens in Bleiburg/Pliberk gezeigten Hitlergrüße legal, jedenfalls nicht strafbar, gewesen seien.“
Wenn da nicht jemand im Gerichtssaal sitzt und auch solche Passagen mitschreibt, dann weiß die Öffentlichkeit nichts davon. Gar nicht so selten erfährt man nicht einmal, dass von einem Gericht ein Verfahren wegen NS-Wiederbetätigung abgehandelt wurde – weil keine Prozessberichterstatter*innen anwesend waren. Die Gründe für das mangelnde Medieninteresse nennt Mahriah Zimmermann in ihrem Beitrag „Rechtsextremismus vor Gericht. Verantwortung und Leerstellen der Prozessberichterstattung“:
„So sind Journalist_innen vor allem bei länger andauernden Verfahren schon nach wenigen Tagen nicht mehr anwesend beziehungsweise haben kaum die Möglichkeit, den gesamten Tag im Gericht zu verbringen. (…) Diese begrenzten Ressourcen führen zu einer Vorauswahl und damit zur Einschränkung der öffentlichen Wahrnehmung.“
Die Konsequenzen begrenzter Ressourcen einerseits und einer auf Zuspitzung und Sensation orientierten Berichterstattung lassen sich etwa auch an unserer Wochenschau für die Vorwoche gut nachvollziehen: Berichte über den Prozess gegen mit dem IS sympathisierenden Tschetschenen, der wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, aber auch wegen Wiederbetätigung und Kinderpornographie vor Gericht stand, fanden sich in fast allen österreichischen Tageszeitungen, während etwa über die insgesamt zehn Personen an vier Tagen umfassende Prozessserie wegen Wiederbetätigung in Salzburg kaum und nur sehr dürr berichtet wurde.
Darum ist die Arbeit von „prozess.report“ und anderen unabhängigen Prozessberichterstatter*innen, deren Rahmenbedingungen in diesem Beitrag dargestellt werden, auch so wichtig. Dazu passend auch der Beitrag von Dirk Müllner und der Antifaschistischen Recherche Graz, „Gretchenfrage Antifa. Zum ambivalenten Umgang von Journalist*innen mit Antifa-Recherchen“, in dem es um die nicht immer friktionsfreie Beziehung zwischen dem Journalismus klassischer Medien und der zumeist langwierigen und intensiven Arbeit von antifaschistischen Rechercheplattformen geht, die dann immer wieder mal die Erfahrung machen mussten, „dass sich ihre Recherchen ohne Quellenangabe mehrere Monate später in Tageszeitungen wiederfanden“. Diese Erfahrung teilen auch wir von SdR.
Warum Antifa-Gruppen „ungeachtet der oft hohen Qualität ihrer Recherche“ oftmals nur der Status von Schmuddelkindern zugeschrieben wird, die man am besten unter den Tisch fallen lässt, das erklären Müllner und die Antifaschistische Recherche Graz ziemlich gut. Was dabei etwas zu kurz kommt, ist der Hinweis, warum eine breite öffentliche Wahrnehmung von Antifa-Recherche und ‑Arbeit für diese oft sehr spezialisierten Gruppen essenziell ist. Das beinhaltet die personellen, politischen und materiellen Reproduktionsmöglichkeiten solcher Gruppen, aber auch schlicht und einfach Beachtung, Anerkennung und (Aus-) Wirkungen dieser Arbeit.
Das alles nehmen wir auch für uns in Anspruch. Wenn dann – etwa im ebenfalls lesenswerten Beitrag von Judith Goetz über „Rechtsextremismus und Medien“ – aber nur die klassischen Medien “profil“ und „standard.at“ mit ihren Berichten über die massiven Plagiate bei „Info-Direkt“ zitiert werden, obwohl sich beide Berichte (dankenswerterweise!) auf die umfangreiche Recherchearbeit von „Stoppt die Rechten“ bezogen, dann ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass die Reputation von klassischen Medien als zitable Quellen auch in Antifa-Kreisen manchmal mehr zählt als die Recherche selbst.

aus der Recherche 2017: Info-Direkt philosophiert über „Heimat, Umwelt und Identität” und bedient sich dafür bei den Arbeitsblättern für SchülerInnen von ARD/rbb (links: Info-Direkt, rechts: ARD-Homepage „Mach dich schlau!”)
Rechtsextremismus. Band 4: Herausforderungen für den Journalismus. Herausgegeben von Judith Goetz, FIPU & Markus Sulzbacher. Mandelbaum Verlag, edition kritik & utopie, Wien, Berlin 2021.
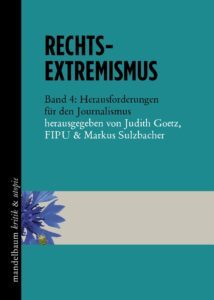
9 Einleitung
16 Entnormalisierung und Positionierung. Über Rechte reden in rechten Zeiten. Mit Rechten reden zur rechten Zeit? (Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit)
30 Rechtsextremismus und Medien. Ein einführender Überblick (Judith Goetz)
52 Ungewollte Komplizenschaft. Über gängige Fallstricke in der medialen Bearbeitung von Rechtsextremismus (Bernhard Weidinger)
72 Der stille Pakt (Markus Sulzbacher)
88 Provokationen, Ängste, Katastrophen. Das rechtsextreme und rechtspopulistische Spiel mit den Medien (Brigitte Bailer)
105 »… in die mediale Debatte eindringen«. Identitäre Selbstinszenierungen und ihre Rezeption durch österreichische Medien (Judith Goetz)
136 Die rechte Eroberung des Cyberspace (Ingrid Brodnig)
156 Verschwörungsmythen in den Medien. Die (Un-)Möglichkeiten der Berichterstattung (Florian Zeller)
177 Zwischen Einhegung und Drohungen. Rechtsextreme Umgangsformen mit Journalist*innen (Fabian Schmid)
194 »Beautys lieben’s blau«. Zum Sexismus in der Berichterstattung über rechte Frauen am Beispiel von Philippa Strache (Bianca Kämpf)
211 Rechtsextremismus vor Gericht. Verantwortung und Leerstellen der Prozessberichterstattung (Mahriah Zimmermann)
236 Kooperation, Kontrolle, Korrektiv. Journalismus, Polizeiarbeit und NS-Wiederbetätigung (Mathias Lichtenwagner)
254 Gretchenfrage Antifa. Zum ambivalenten Umgang von Journalist*innen mit Antifa-Recherchen (Antifaschistische Recherche Graz, Dirk Müllner)
282 Beharrliche Bilder. Bildsprache und Rechtsextremismusprävention (Andreas Hechler)
298 Zur Anatomie rechter Shitstorms und wie eins sich dagegen wehren kann (Fanny Rasul)
314 Kurzbiografien
