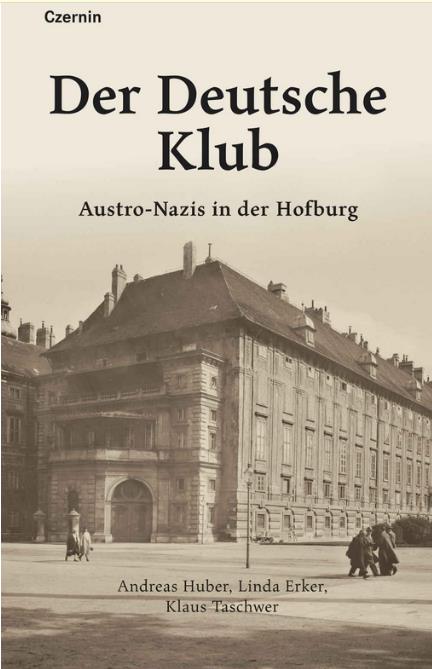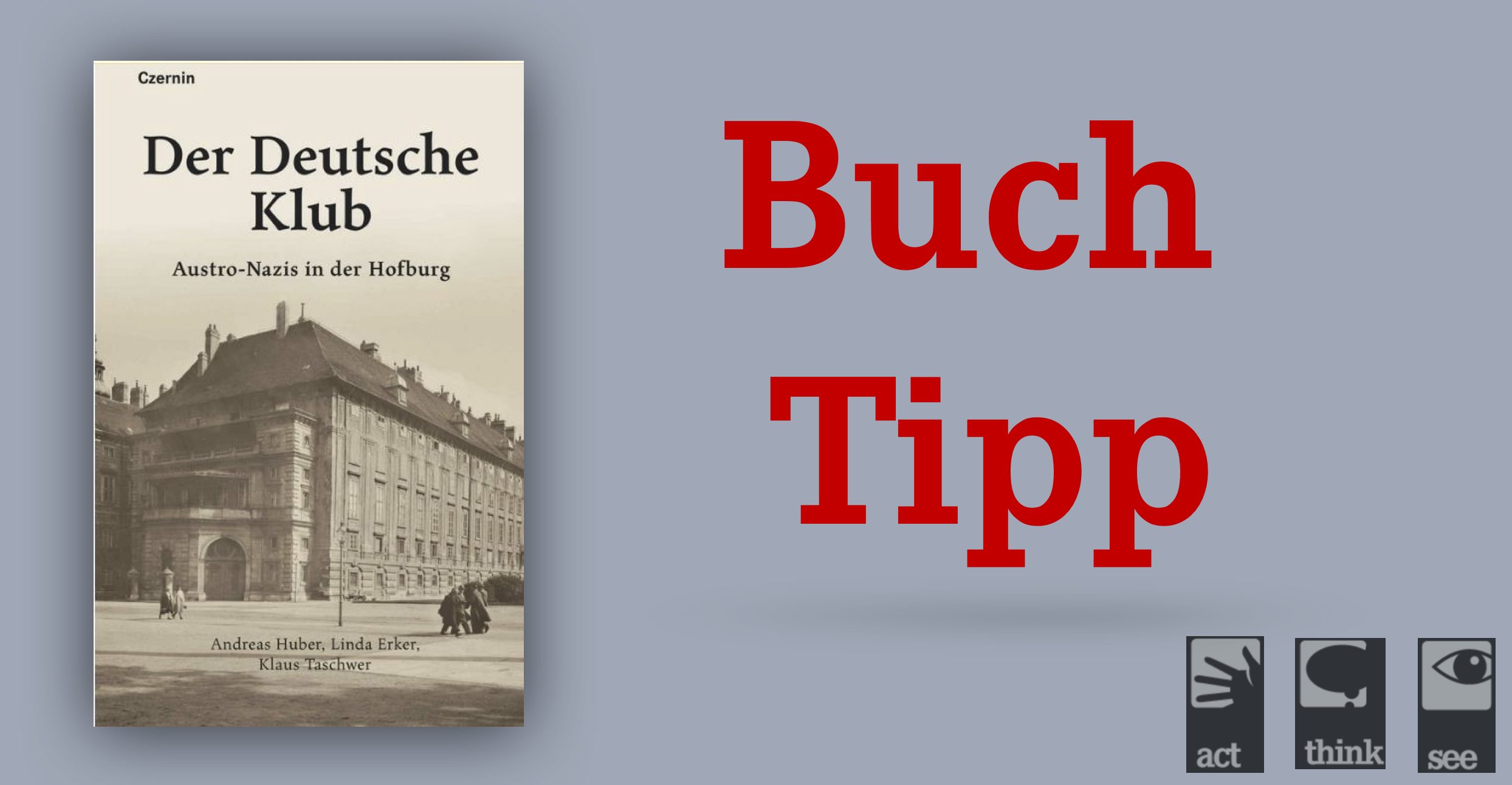Wenn es eine Kontinuität gibt, die von der Gründung des Deutschen Klubs im Jahr 1908 bis zum Neuen Klub in der Zweiten Republik reicht, dann ist das wohl der Deutschnationalismus und der Antisemitismus. Einen „Verein im Geiste Georg Schönerers“ betiteln die AutorInnen des Buches „Der Deutsche Klub. Austro-Nazis in der Hofburg“ das Kapitel über dessen Gründungsgeschichte. Damit ist eigentlich schon fast die Programmatik des Vereins umrissen: Schönerer, der radikale Antisemit, Vorbild für Hitler, Eiferer für eine großdeutsche Lösung, Burschenschafter. Der Deutsche Klub wurde dementsprechend auch von Korporierten aus der Taufe gehoben: der Vereinigung alter Burschenschafter und dem Kyffhäuserverband. Der wesentliche Unterschied war allerdings, dass der Klub die Spaltungen und die Sektiererei, für die Schönerer in der deutschnationalen Szene geradezu paradigmatisch stand, überwinden wollte. Daher fanden sich in ihm auch die Vertreter so ziemlich aller deutschnational gesinnten Parteien – von der Deutschen Fortschrittspartei über die Deutschradikalen bis hin zur Deutschen Arbeiterpartei, aus der dann 1918 die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) des Walter Riehl hervorging.
Der Anwalt Walter Riehl, der ein besonders eifriger und radikaler Proponent des Deutschen Klubs war, war übrigens der Verteidiger des Mörders von Hugo Bettauer, der Schattendorf-Mörder und weiterer Rechtsextremer, die man heute wohl in die Rubrik Rechts- oder Nazi-Terroristen einordnen würde. Am Beispiel des Prozesses gegen den Bettauer-Mörder Otto Rothstock zeigt das Buch auf, wie die Netzwerke des Deutschen Klubs funktioniert haben. Verteidiger war das Klubmitglied Walter Riehl, Ankläger bzw. Staatsanwalt war Franz Bucek,
der spätestens 1919 zum Deutschen Klub gestoßen war. Möglicherweise hatte Riehl, der als Vorstandsmitglied für Neuaufnahmen in den Verein zuständig war, diese sogar abgesegnet. Auch der Vorsitzende Ernst Ramsauer wies – zumindest in den folgenden Jahren – Verbindungen zum Deutschen Klub auf und referierte im November 1928 in der Hofburg zur ‚Ständebewegung‘. (S. 73)
Zum Staatsanwalt wird die Tageszeitung „Der Tag“ aus dem Jahr 1927 zitiert, in der es heißt: „Das, was er Anklagerede nannte, war in Wahrheit ein Plädoyer für den Angeklagten und charakterisiert sich am besten dadurch, daß es nicht einmal in einem Strafantrag gipfelte.“ (S. 73)
Rothstock wurde folgerichtig freigesprochen, aber in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, aus der er nach einem Rekurs von Riehl beim Obersten Gerichtshof (OGH) nach 18 Monaten wieder entlassen wurde. Riehls Adressat beim OGH war dessen Vorsitzender Julius Roller – ebenfalls Mitglied im Deutschen Klub. Der andere, zweite Vorsitzende des OGH, war Franz Dinghofer – natürlich auch im Deutschen Klub vertreten. Nach dem Antisemiten und NSDAP-Mitglied Dinghofer ist übrigens das in FPÖ-Nähe angesiedelte gleichnamige Institut benannt. Auch einen Dinghofer-Preis, ein Symposium und eine Straße in Linz sind nach ihm benannt.
Mit der Hofburg, in der der Vorsitzende des Geschworenengerichts, Ernst Ramsauer im November 1928 referierte, waren natürlich die Räumlichkeiten im Leopoldinischen Trakt gemeint, wo der Deutsche Klub ab 1923 seinen Sitz hatte. Der Bundespräsident residierte in der Ersten Republik noch nicht im Leopoldinischen Trakt, sondern am Ballhausplatz, im Bundeskanzleramt, also unmittelbar gegenüber. Aber die Hofburg war natürlich auch damals ein schwer symbolisch aufgeladener Ort der Macht (so wie jetzt für die Burschenschaften und ihren Ball). Schon vor dem tödlichen Attentat auf Engelbert Dollfuß und dem gescheiterten Putschversuch der Nazis im Juli 1934 war der Deutsche Klub, der zu dieser Zeit schon deutlich auf NS-Kurs war, Gegenstand von medialen Vermutungen („Der Deutsche Klub – eine Nazi-Zelle?“) und von polizeilichen Ermittlungen, die aber – so wie die Ermittlungen nach dem Attentat – erfolglos blieben. Die AutorInnen dazu trocken: „Das war wohl den guten Verbindungen des Deutschen Klubs zur Polizei geschuldet.“ (S. 138)
Das muss man sich einmal vorstellen: Obwohl der Hochverratsprozess gegen die Dollfuß-Attentäter im Jahr 1935 die Verwicklungen des Deutschen Klubs in den Putschversuch der Nazis offenlegte, ja sogar Treffen von Putschisten in den Räumlichkeiten nachgewiesen wurden (S. 140), blieben der Deutsche Klub und seine Räumlichkeiten in der Hofburg weitgehend unbehelligt – er durfte bis Oktober 1939 noch weiter existieren. Dann machten die Nazis, denen der Klub (so wie die Burschenschaften) den Weg bereitet hatten, Schluss mit dem Verein.
Kapitel 7 des Buches widmet sich den Kriegsverbrechern, die aus dem Deutschen Klub hervorgegangen waren und die in den ersten Kriegsverbrecherlisten nach 1945 auch noch angeführt waren. Sie konnten sich jedoch, teilweise durch dreiste Lügen, herausreden und stießen schon bald wieder auf für sie freundliche politische Verhältnisse.
Nach dem Abzug der Alliierten 1955 und der Amnestierung der schwer belasteten Nazis 1957 ging es dann auch schnell mit der Neugründung des Deutschen Klubs. Bereits 1956, wenige Tage nach der Gründung der FPÖ, hatte sich der Rechtsanwalt Wilhelm Buchta schriftlich bestätigen lassen, dass der Deutsche Klub 1939 durch Gauleiter Bürckel aufgelöst worden war – ein „Persilschein“ sozusagen. Weil der Name aber doch etwas zu streng nach dem NS roch, wurde der alte Deutsche Klub als Neuer Klub am 20. Mail wiedergegründet und schon bald mit Funktionären, Mitgliedern und Referenten befüllt, die sich der alten Zeit und der alten Gesinnung weiterhin verpflichtet fühlten – wie etwa der Gründungsobmann Erich Führer, ein Burschenschafter und illegaler Nazi.
Das Kapitel zum Neuen Klub enthält zwar nur wenige Anmerkungen zu den letzten Jahren, ist aber dennoch so aufschlussreich wie die vorhergehenden. Vereine wie der Neue Klub sind Teil eines Netzwerkes von teilweise öffentlich kaum sichtbaren rechtsextremen Organisationen und Strukturen, die über die Jahrzehnte hinweg im Umfeld der FPÖ tätig sind und der Partei auch in schlechteren Zeiten Macht, Einfluss und rechtsextreme Ideologie sichern.
Andreas Huber, Linda Erker, Klaus Taschwer, Der Deutsche Klub. Austro-Nazis in der Hofburg. Czernin-Verlag, Wien 2020